Das Portrait:
Bernard Overberg (1754-1826)
von Mechtild Wolff
von Mechtild Wolff
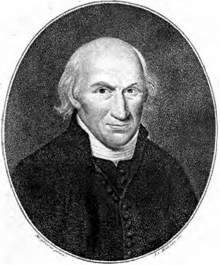
Bernard Heinrich Overberg wurde am 1. Mai 1754 als jüngstes von
vier Kindern in Höckel, im Kirchspiel Voltlage, geboren. Sein Vater war
Heuerling und Tödde, er zog mit der Töddenkiepe über die Lande, um das
schmale Einkommen aufzubessern.
Bernard Overberg war ein schmächtiges, oft kränkelndes Kind,
das mit vier Jahren noch nicht laufen konnte. Nach dem Willen des Vaters
sollte er eigentlich die lange Töddentradition der Familie fortsetzen,
aber der Pfarrer von Voltlage, der den scharfen Verstand des Jungen
erkannt hatte, sagte: „Do sit wull ein Pastor drin!“
Der Unterricht in der Volksschule fesselte ihn wenig. Er soll
acht ABC Bücher gebraucht haben, ehe er das Lesen erlernte. Wenn er
später immer wieder auf Mittel und Wege sann, den Kindern das Lernen
leichter und angenehmer zu machen, wird er wohl an seine eigene
Schulzeit zurückgedacht haben.
Als sich die Verwandten Ellerhorst in Rheine bereit erklärten,
ihn bei sich aufzunehmen, konnte der 17jährige Bernard das Gymnasium der
Franziskaner in Rheine besuchen (1771-1774). Er zeichnete sich durch
großen Fleiß und Ausdauer aus. Er war Frühaufsteher, denn er wollte den
Tag nutzen. Einen Wecker hatte er natürlich nicht, aber in seinem Zimmer
hing eine Kuhglocke. Er hatte einen Tagelöhner, der um 5 Uhr zur Arbeit
ging, gebeten, frühmorgens an dem Band zu ziehen, das vor dem Fenster
hing. Natürlich passierte es immer mal wieder, dass seine Mitschüler ihm
einen Streich spielten und ihn mitten in der Nacht aus dem Schlaf
läuteten.
Den Franziskanern fiel bald Overbergs scharfer Verstand und
seine besondere Redegabe auf, darum versuchten sie ihn an den Orden zu
binden. Bernard Overberg aber entschied sich, an der noch jungen
Universität in Münster Theologie und Philosophie zu studieren. Durch
Hauslehrertätigkeiten bestritt er seinen Lebensunterhalt, bis er endlich
im Priesterseminar einen Freiplatz bekam.
Am 20. Dezember 1779 ging sein sehnlichster Wunsch in
Erfüllung: Er wurde zum Priester geweiht. Am Weihnachtstag konnte er in
seiner Voltlager Heimatpfarre sein Primizamt feiern.
Seine erste Kaplanstelle bekam er 1780 ganz in unserer Nähe, in
Everswinkel, damals ein Dorf der Weber und Ackerleute, seinem Heimatdorf
sehr ähnlich. Er fühlte sich hier sehr wohl und konnte sich drei Jahre
lang insbesondere der Unterrichtung der Jugend widmen. Kaplan Overberg
praktizierte eine lebensnahe Katechese, die die Kinder durch lebendige
Erzählungen ansprach. Er führte viele Gespräche mit den Kindern, das war
damals sehr ungewöhnlich. Durch seine Lehrtätigkeit bekam er einen
intensiven Einblick in den Schulalltag und erkannte schnell, dass der
Zustand der Schulen sehr besorgniserregend war.
Wie war die Schulsituation damals vor über 240 Jahren?
Nach dem 30jährigen Krieg (1618-48), als sich das Leben in den
deutschen Landen wieder normalisiert hatte, waren überall Schulen
entstanden, zuerst in den Städten und nach und nach auch in den Dörfern.
Im Münsterland setzte sich der Fürstbischof Christoph Bernhard von Galen
für die Einrichtung von Schulen ein.
Natürlich sind sie nicht mit den heutigen Schulen zu
vergleichen. Von einer regelmäßigen Teilnahme am Unterricht konnte nicht
die Rede sein. Vor allem in den Sommermonaten behielten die Eltern ihre
Kinder lieber zu Hause. Die Mädchen halfen im Haushalt und die Jungen
gingen mit aufs Feld. Schule fand im Sommer nicht statt. Der Dorflehrer
wurde dann zum Tagelöhner und musste sein Brot bei den Bauern durch
Feldarbeit verdienen. Sehr oft gab es keinen Lehrer und die Ausbildung
der Jugend wurde dem Küster der Gemeinde übertragen.
Auf dem Stundenplan standen die Fächer, die der Messgestaltung
dienten: Religion, Lesen und Chorgesang für den Gottesdienst. Der
Unterricht in diesen Fächern war kostenlos. Wer dagegen auch noch
Schreiben lernen wollte, der musste bezahlen. Rechnen war so gut wie
unbekannt.
So ist es nicht verwunderlich, dass ein Dorfschulmeisterlein
kein großes Ansehen genoss. Er hatte keine pädagogische Ausbildung und
seine Sorge galt in erster Linie der Ernährung seiner eigenen Familie.
Die Schulverhältnisse im Münsterland mussten dringend
reformiert werden. Das gelang erst 1782. Der Fürstbischof Friedrich von
Königsegg-Rothefels erließ eine Verfügung zur Verbesserung der
ländlichen Schulsituation. Er fand in seinem Generalvikar Franz von
Fürstenberg einen idealen „Kultusminister“. Der hatte sich schon in
Münster um die Gründung der Universität und die Förderung der Gymnasien
verdient gemacht.
Fürstenberg nahm seine Aufgabe sehr ernst, es suchte einen
Pädagogen, dem er die Ausbildung der Lehrer anvertrauen konnte. Ihm
wurde der Name Bernard Overberg genannt. Overberg war Kaplan in
Everswinkel und hatte sich einen Namen gemacht als begnadeter Seelsorger
im Umgang mit den Kindern.
Darum reiste Freiherr Franz von Fürstenberg an einem Sonntag
nach Everswinkel, um an Overbergs Christenlehre teilzunehmen. Den
Postillion der Extrapost hatte er angewiesen, kurz nach 2 Uhr an der
Dorfkirche in Everswinkel einzutreffen, so konnte er unbemerkt in die
Kirche gelangen und unerkannt an der Christenlehre teilnehmen. Franz von
Fürstenberg war so begeistert von dem lebensnahen Unterricht des
Priesters und Pädagogen Overberg, dass er ihn vom Fleck weg mit dem
Aufbau einer Lehrerbildung beauftragte.
Overberg ging ganz neue Wege: Er begründete die „Normalschule“,
eine Schule, in der Lehrer ihr Handwerk lernen konnten. Das war damals
revolutionär.
Auf diese bahnbrechende Aufgabe musste sich auch Overberg erst
vorbereiten. Er studierte die Werke der großen Erzieher, von Sokrates
und Platon über die Humanisten und die Jesuiten bis zu den
Veröffentlichungen seiner Zeitgenossen. Die führenden Köpfe der
geistigen Elite des Landes lernte Overberg im Hause der Fürstin von
Gallitzin kennen.
Als weitere Vorbereitung bereiste Overberg die Schulen des
Landes und musste feststellen, dass die im Amt befindliche Lehrerschaft
dringend einer gründlichen Anleitung bedurfte.

![]()
Overbergs zentrales Erziehungsprinzip war die „Pädagogik vom Kinde
aus“. Er wollte weg von der bislang praktizierten Memorierschule, hin zu
Eigentätigkeiten und selbständigem Denken.
1783 nahm die „Normalschule“ ihre Arbeit auf. In Sommerkursen,
die über drei Monate gingen, wurden die Lehrer erstmals fachlich und
didaktisch ausgebildet. Wenn diese Lehrer die Abschlussprüfung bestanden
hatten und sich auch später den Revisionen in ihrer eigenen Schulstube
stellten, bekamen sie ein festes Gehalt aus der Bistumskasse. Ein großer
Fortschritt, denn damit hatte der „arme Dorfschullehrer“ endlich eine
finanzielle Unabhängigkeit und konnte sich auf seine Arbeit mit den
Schülern konzentrieren.
Overbergs Schulungen für die Lehrer bestanden nicht nur aus
theoretischen Vorlesungen. Er demonstrierte auch Unterricht, indem er
seinen Lehrern praktische Schulstunden vorführte und sie mit neuen
Unterrichtsmaterialien vertraut machte. Er führte Schulbänke,
Lehrerpulte, Wandtafeln und Kreide in den münsterländischen Schulen ein.
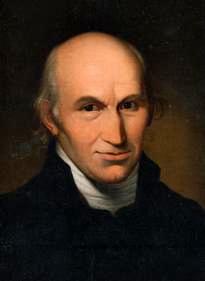 Overberg
verfasste Schulbücher für die Kinder und Lehranweisungen für die Lehrer.
Zehn Jahre nach der Eröffnung der „Normalschule“ ließ er eine Methodik
und Didaktik an die Lehrer verteilen mit dem Titel: („Anweisungen zum
zweckmäßigen Schulunterricht für Schullehrer im
Hochstift Münster“) Natürlich erschien das Werk auch
in plattdeutscher Sprache, denn das war nach wie vor die normale
Umgangssprache.
Overberg
verfasste Schulbücher für die Kinder und Lehranweisungen für die Lehrer.
Zehn Jahre nach der Eröffnung der „Normalschule“ ließ er eine Methodik
und Didaktik an die Lehrer verteilen mit dem Titel: („Anweisungen zum
zweckmäßigen Schulunterricht für Schullehrer im
Hochstift Münster“) Natürlich erschien das Werk auch
in plattdeutscher Sprache, denn das war nach wie vor die normale
Umgangssprache.
Seine erfolgreich weitergebildeten Lehrer nannten sich nun
stolz „Schüler Overbergs“ und waren in ihren Heimatorten angesehene
Schulmeister, bald auch ehrfurchtsvoll „Magister“ genannt. Mehr als 40
Jahre arbeitete Overberg als „Lehrer der Lehrer“.
1809 wurde Bernard Overberg Regens des Priesterseminars und
reformierte auch die Ausbildung der Theologiestudenten. Er wohnte direkt
neben der Überwasserkirche im Priesterseminar - bis zu seinem Tode am 9.
November 1826. Unter großer Anteilnahme seiner Schüler und der
Bevölkerung wurde er auf dem Überwasserfriedhof begraben. Seit 1904, dem
Jahr seines 150. Geburtstages, ruhen seine Gebeine im Chor der
Überwasserkirche zu Münster.
1930 bauten die beiden ehemaligen Seminarlehrer Wessling und
Krusche ein Haus an der neuen Straße zwischen Diekamp und Düsternstraße,
die auf ihren Antrag „Overbergstraße“ genannt wurde.
Quellen:
Wilhelm Münter: Bernard Overberg - Lehrer der Lehrer aus
„Kirche und Leben“ vom 7.11.1951
Wilhelm Bootsveld: „Zum Gedenken an Bernhard Overberg „Lehrer
der Lehrer“ aus: Rheiner Volksblatt Nr.274 vom 26.11.1983
August Schröder: Bernhard Overberg, der „Lehrer der Lehrer“
Westf. Heimatkalender 1977 Jg. 31
Briefe von Bernard Overberg, Archiv Wolff
Persönlichkeiten
Heinrich Blum, von allen "Mister Blum" genannt
Franz Joseph
Zumloh, der Begründer des Josephshospitals
Maria Anna
Katzenberger und Heinrich Ostermann
Hermann Josef
Brinkhaus,
Gründer der Firma Brinkhaus
Eduard
Wiemann und die Villa Sophia
Anna
Franziska Lüninghaus, Gründerin der Marienstiftung
Wilhelm
Zuhorn, Geheimer Justizrat und Geschichtsforscher
Bernard
Overberg, der Lehrer der Lehrer
Arthur
Rosenstengel, Seminarlehrer, Musikerzieher und Komponist
Pauline
Hentze, Begründerin der Höheren Töchterschule
Franz
Strumann, Pastor und Förderer der höheren Mädchenbildung
Dr. Maria
Moormann, die mutige Direktorin der Marienschule
Josef Pelster,
der Schulrat und Naturfreund
Wilhelm
Diederich, Bürgermeister von 1869-1904
Hugo
Ewringmann, Bürgermeister von 1904-1924
Theodor
Lepper, Stadtrendant und Retter in den letzten Kriegstagen
Clara Schmidt,
Kämpferin für die Frauenliste im Stadtparlament
Elisabeth
Schwerbrock, eine hochengagierte Stadtverordnete,
Eugenie
Haunhorst, die Kämpferin für ihre Heimatstadt
Paul Spiegel,
Vorsitzender des Zentralrats der Juden in Deutschland
Paul
Schallück, der vergessene Nachkriegsschriftsteller
Heinrich
Friedrichs, ein Warendorfer Künstler
Theo
Sparenberg, Kinokönig und Tanz- und Anstandslehrer
Wilhelm
Veltman, Retter der historischen Altstadt
Rainer. A. Krewerth, ein schreibender Heimatfreund
Prof. Dr. Alfons
Egen
ein begnadeter Lehrer und Heimatfreund
Änneken Kuntze und ihre Schwester Lilli
Elisabeth Schwerbrock, Stadtverordnete in Warendorf
Anni Cohen und ihre Familie - von Warendorf nach Südafrika und Palästina
Eduard Elsberg erbaute das erste große Kaufhaus in Warendorf
Heimatverein Warendorf e. V., Vorsitzende: Beatrix Fahlbusch, Düsternstraße 11, 48231 Warendorf, Tel: 02581 7 89 59 03
E-Mail: vorstand@heimatvereinwarendorf.de
Copyright: Heimatverein Warendorf (C) 2005 -2025 (Impressum und Datenschutzerklärung) Mitglied werden
